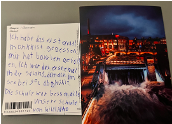Inhalt der Aktivität: Erasmus+-Mobilität nach Tampere, Finnland
Die Erasmus+-Aktivität bestand in einer einwöchigen Schülermobilität nach Tampere (Finnland) als Gegenbesuch zu einer Schülerinnengruppe einer finnischen Förderschule, die im Vorjahr unsere Schule in Dortmund besucht hatte. Zielgruppe waren Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf.
Die Maßnahme verfolgte mehrere Lernziele:
- Förderung der mündlichen Kommunikationsfähigkeit in Englisch,
- Erweiterung interkultureller Handlungskompetenzen,
- Förderung von Selbstständigkeit und sozialer Teilhabe,
- Reflexion schulischer Strukturen und Lebenswelten im internationalen Vergleich.
1. Sprachliche Kommunikation in Alltagssituationen
Ein zentrales Lernfeld war die Anwendung der englischen Sprache in authentischen Kommunikationssituationen. Die Schüler*innen hatten im Vorfeld per E-Mail Kontakt mit den finnischen Teilnehmenden aufgenommen. Vor Ort galt es, diese Kontakte in persönliche Kommunikation zu überführen.
Englisch wurde als Verständigungssprache in verschiedenen Alltagssituationen benötigt: beim Einkaufen, in der Unterkunft, beim Lesen von Speisekarten und bei Freizeitaktivitäten. Teilnehmende nutzten auch digitale Hilfsmittel (z. B. Übersetzungs-Apps), um Inhalte zu erschließen. Ziel war nicht die sprachlich korrekte Anwendung, sondern die funktionale Nutzung zur Lösung konkreter Aufgaben. Die Teilnahme wurde an individuelle sprachliche Voraussetzungen angepasst.
2. Schulpräsentation und institutioneller Austausch
Die Schüler*innen bereiteten im Vorfeld eine PowerPoint-Präsentation über ihre Schule vor, die sie in einfacher englischer Sprache vor der finnischen Lerngruppe präsentierten. Im Anschluss fand ein Austausch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Schulsysteme statt.
Dabei wurden Unterschiede in Ausstattung, Unterrichtsorganisation und schulischen Unterstützungsangeboten thematisiert. Die Auseinandersetzung führte bei den Teilnehmenden zu einem erweiterten Blick auf die eigene Schule und regte zur Reflexion über mögliche Veränderungen an (z. B. Beteiligung am Schüler*innenparlament).
3. Soziale Interaktion und niedrigschwellige Begegnungsformate
Das Programm war so gestaltet, dass Teilhabe unabhängig von individuellen Einschränkungen möglich war. Der Einstieg erfolgte über gemeinsame Aktivitäten mit niedrigem Anforderungsniveau (z. B. Bowling), um Berührungsängste abzubauen und erste Kontakte zu ermöglichen.
Weitere Programmpunkte wie ein gemeinsamer Kletterausflug förderten Kooperation und gegenseitige Unterstützung. Beim Anlegen der Kletterausrüstung oder beim Klettern selbst war Kommunikation (verbal und nonverbal) erforderlich. Hier konnten Teilnehmende Verantwortung übernehmen, sich gegenseitig helfen und persönliche Herausforderungen (z.B. Höhenangst) bewältigen.
4. Kulturelle Inhalte und Freizeitgestaltung
Ein Programmtag fand an einem See außerhalb der Stadt statt. Dort wurden typische Freizeitaktivitäten in Finnland erprobt (z. B. Sauna, Rudern, Angeln). Ziel war das Kennenlernen kultureller Besonderheiten und ein Perspektivwechsel auf Alltagsgewohnheiten. Auch hier standen gemeinsames Handeln und freiwillige Teilnahme im Vordergrund.
Der Aufenthalt ermöglichte zudem informelle Lernprozesse im interkulturellen Kontext: Beobachtung, Nachahmung, wechselseitiges Zeigen und Erklären bestimmten viele Situationen. Dabei war keine kontinuierliche sprachliche Verständigung erforderlich, sondern situatives Lernen durch Handeln.
5. Persönliche Entwicklung und Selbstwirksamkeit
Ein weiteres Lernziel bestand in der Stärkung von Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit. Viele Teilnehmende reisten erstmals mit dem Flugzeug ins Ausland. Die damit verbundenen organisatorischen Abläufe (Check-in, Sicherheitskontrollen, Orientierung am Flughafen) wurden im Vorfeld vorbereitet und vor Ort gemeinsam begleitet. Die Jugendlichen konnten so konkrete Erfahrungen mit Mobilität und Selbstorganisation machen.
Die Fahrt war so angelegt, dass alle Schüler*innen – unabhängig von ihren sprachlichen oder sozialen Voraussetzungen – im eigenen Tempo aktiv teilnehmen oder auch zunächst beobachtend agieren konnten. Pädagogisches Ziel war es, individuelle Lernfortschritte zu ermöglichen, ohne formale Leistungsanforderungen zu stellen.
Fazit:
Die Maßnahme verband sprachliche, soziale und interkulturelle Lernziele mit einem handlungsorientierten Zugang. Die Schüler*innen konnten ihre Englischkenntnisse in realen Situationen anwenden, neue soziale Kontakte knüpfen und kulturelle Unterschiede wahrnehmen. Die Erfahrungen stärkten das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und förderten den Blick über den eigenen Lebenshorizont hinaus.
Motto der Maßnahme:
Sich etwas trauen. Neue Erfahrungen machen. Selbstvertrauen gewinnen.